
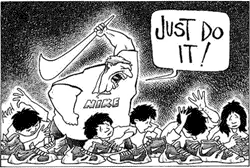
 |
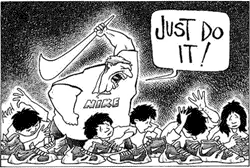 |
Die globale
Monarchie der Konzerne
oder die Enteignung des politischen Raums
Das Ende des Nationalstaates
Transnationale Konzerne agieren in ihrem ökonomischen und damit auch politischen
Handeln weit über nationale Grenzen hinaus. Ihr Interesse gilt der Deregulierung
und Privatisierung aller Bereiche in den nationalen Volkswirtschaften, in denen
sie schon wirken oder künftig wirken wollen. Die fortschreitende Verschmelzung
der einzelnen nationalen Wirtschaften, die bislang noch vom kulturellen Erbe,
besonderen Handlungs- und Vorstellungsweisen ihrer Bevölkerung geprägt
waren, zu einem einheitli-chen Weltmarkt bezeichnet man mit dem Schlagwort Globalisierung
(siehe: Jean Ziegler, „Herrscher der Welt“, München 2003).
Die gewachsenen gesellschaftlichen Strukturen der einzelnen Staaten werden zerstört
und den Konzernen verfügbar ge-macht. Die Reste nationaler demokratischer
Instanzen verlieren immer mehr an politi-schem Einfluss. Waren die multinationalen
Konzerne noch als deutsche, US-amerikanische oder japanische Unternehmen anzusprechen,
die zwar weltweit produzieren ließen aber einen nationalen Standort hatten,
so sind transnationale Konzerne solche, die jede staatliche Anbindung verloren
haben und beispielsweise ihr Steuerbüro in Irland, ihre Abrechnungsstelle
auf den Kaiman-Inseln, ihr Service Center in Südkalifornien und ihre Briefkastenadresse
in Liechtenstein haben.
Auf globaler Ebene (UNO) gibt es keine regulierenden demokratischen Kontrollgremien,
keine Schutzmechanismen, die mit einem ordnenden gesetzgeberischen Handeln die
ungebremst agierenden wirtschaftlichen Gewinn- und damit Machtinteressen der
ökonomischen Multis bändigen. Die heute rund 45000 transnationalen
Konzerne – vor 20 Jahren waren es nur 7000 – beherrschen das politische
Kräftespiel auf allen Ebenen. 200 der führenden transnationalen Unternehmen
sind so mächtig, dass ihr gemeinsamer Jahresumsatz die wirtschaftliche
Gesamtleistung von 182 der 191 Län-der der Erde übertrifft. Zu den
100 größten Wirtschaftseinheiten der Welt gehören 53 Konzerne
und nur 47 Staaten. Wal Mat, der zweitgrößte Konzern der Welt, besitzt
ein größeres Wirtschaftsvolumen als die Volkswirtschaften von 178
Ländern.
Die neue politische Klasse
In der Vergangenheit versuchte die politische Klasse, einen Konsens zwischen
den unterschiedlichsten gesellschaftlichen Gruppen herzustellen. Zu diesen Gruppen
gehörte auch die Wirtschafts-elite, die eine der mächtigsten Gruppen
im Spiel der Kräfte war. „Wo der Markt seiner Eigengesetzlichkeit
überlassen ist, kennt er nur Ansehen der Sache, kein Ansehen der Person,
keine Brüderlichkeits- und Pietätspflichten ...Sie alle bilden Hemmungen
der freien Entfaltung der nackten Marktvergemeinschaftung“ (Max Weber).
Im Prozess der Konsensbildung übte deshalb die politische Klasse ihre ordnungspolitische
Macht aus. Sie regulierte durch Arbeitsmarkt- und Steuerpolitik, durch öffentliche
Investitionen sowie mit Hilfe von Gesetzen im Arbeitsschutz und auf dem Gebiet
des Umweltschutzes das Wirtschaftsgebaren der Unternehmen.
Der Neoliberalismus als Marktideologie plädiert für einen schlanken
(schwachen) Staat und behauptet, der Markt sei der Ordnungsfaktor in der Gesellschaft;
er reguliere nicht nur das wirtschaftliche Handeln, sondern auch die gesellschaftlichen
Prozesse. Die transnationalen Konzerne kaufen sich in die mediale Öffentlichkeit
ein, setzen mit Hilfe von Bestechung, Parteienfinanzierung und angebotener Medienpräsens
ihre Wirtschaftslobbyisten an die Schalthebel von Politik und Gesellschaft.
Sie denunzieren die Forderung nach sozialer Gerechtigkeit als Neid-Agitation,
die den Kollektivneid auf die Leistungsträger der Wirtschaft schürt.
Die neue Klasse von Politikern stammt selbst aus der Wirtschaftselite. Politiker
wie George W, Bush, der erst mit Hilfe der Ölkonzer-ne an die Macht gelangte,
wie Silvio Berlusconi, der vor seiner politischen Karriere schon Führer
eines Wirtschaftsimperiums war oder wie der mexikanische Präsident Vincente
Fox, der als Vize-Präsident von Coca Cola fungierte sind beredte Beispiele
dafür, dass diese neue politische Klasse allein im Interesse einer gesellschaftlichen
Gruppe, nämlich der Wirtschaftselite, Politik betreibt. Die Repräsentanten
dieser Elite haben es auf Grund ihrer Herkunft, ihrer eigenen ökonomischen
Machtposition oder der hinter ihnen stehenden Wirtschaftskraft nicht mehr nötig,
einen Konsens zwischen den Interessengruppen innerhalb des Staates herzustellen.
Der demokratische Ausgleich zwischen Sozial- und Wirtschaftspolitik ist nicht
mehr von Nöten. Die Arbeitnehmer, die Arbeitslosen und Rentner sind im
politischen Gefüge machtlos geworden. Der Sozialstaat behindert nur die
Gewinnmaximierung der Konzerne.
Die Diktatur der Ökonomie
Mit der neuen politischen Klasse haben sich auch die politischen Inhalte verändert.
„Denn mehr als jemals zuvor bestimmen heute die transnationalen Unternehmen
die Inhalte der Politik. Das führt so weit, dass die hervorragend organisierte
Wirtschaftslobby den Regierungen ihr Regierungsprogramm diktiert. Die transnationalen
Unternehmen regieren über die Konferenzen der Welthandelsorganisation (WTO)
de facto bis in nationale Parlamente hinein“ (Maude Barlow, Leiterin des
International Forum on Globalisation im dlf am 07.03.04). Die kanadische Ökonomin
Maude Barlow gibt dafür ein Beispiel: Auf der internationalen Konferenz
für nachhaltige Entwicklung und Um-weltschutz im Sommer 2003 in Südafrika
sorgte die Allianz zwischen transnationalen Unternehmen, Unternehmer-Politikern
und der internationalen Handelsbürokratie dafür, dass internationale
Regeln für einen weltweiten Umweltschutz und für Nachhaltigkeit letztendlich
unter den Tisch fielen. „Unter dem Schlagwort von der »Freiheit
des Marktes« und dem »Freien Handel« werden Deregulierung,
Privatisierung und der Verkauf gesellschaftlichen bzw. staatlichen Eigentums
an transnationale Unternehmen betrieben. Dies sind die eigentlichen inhaltlichen
Ziele dieser neuen »globalen Monarchie«“ (M. Barlow, ebenda).
Diese Ziele werden mit Hilfe ihrer Lobbyisten in Weltbank, WTO und Weltwährungsfonds
durchgesetzt. Beispielsweise räumt das Nordamerikanische Freihandelsabkommen
(NAFTA) den transnationalen Konzernen bei einer Behinderung von Investitionen
das Recht ein, den Unterzeichner-Staat zu verklagen. Kanada verbot aus Gründen
der Gesundheitsvorsorge und des Umweltschutzes den grenzüberschreitenden
Handel mit MMT (einem giftigen Zusatz in Kraftstoffen). Der Herstellerkonzern
verklagte den Staat Kanada auf mehrere Millionen Dollar Schadenersatz für
entgangene Profite. Der kanadische Staat nahm das Verbot zurück und nimmt
in Kauf, dass das Gift MMT das Grundwasser verunreinigt. Für das eine Jahr
unter dem Handelsverbot erhielt der Konzern zig Millionen Dollar Schadenersatz
und der kanadische Premierminister musste einen offiziellen Entschuldigungsbrief
an die Konzernleitung richten. Auf ähnliche Weise herrschen transnationale
Agrarkonzerne über die Grundnahrungsmittelproduktion. Hatten bisher arme
Länder wie Indien oder Ägypten bei guten Ernten Nahrungsmittel gespeichert,
um in schlechten Zeiten ihre Bevölkerung ernähren zu können,
verbietet die WTO in einem Abkommen das „Horten“ von Nahrungsmitteln.
So sind diese Staaten bei schlechten eigenen Ernten gezwungen, auf dem Weltmarkt
hinzu zu kaufen. Seither gibt es in diesen Ländern wieder Hungertote. In
den Philippinen wurde die Regierung von Minenkonzernen gezwungen, ihnen Schürfrechte
auf 25 Jahre einzuräumen, die erwirtschafteten Profite steuerfrei ins Ausland
transferieren zu können und in den Minengebieten Polizeirechte durch ihren
privaten „Wachschutz“ gegen Minenarbeiter und Eingeborene wahrzunehmen.
Das alles kann mittlerweile die globale Monarchie der Konzerne bei ihren „Untertanen“
durchsetzen.
Klaus Körner