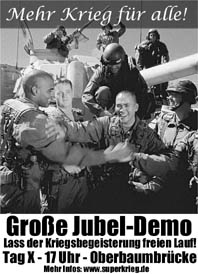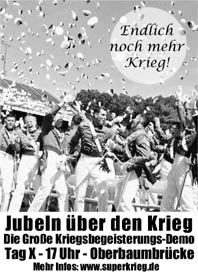Januar 2003
|
|
|
Bush-Doktrin oder
Völkerrecht?
Mit der UNO-Charta hat der
Krieg aufgehört, ein völkerrechtlich zulässiges Mittel der Politik zu sein.
Artikel 2 Ziffer 4 verbietet den Staaten die «Androhung oder Anwendung von
Gewalt», und zwar unabhängig vom «gerechten Grund », den eine Konfliktpartei
für sich reklamieren möchte. Gewalt zur Durchsetzung des Rechts steht einzig
und allein dem Sicherheitsrat zu. Nur wenn dieser nicht willens oder in der
Lage ist, «die zur Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit
erforderlichen Maßnahmen» zu treffen, haben die betroffenen Staaten «das
naturgegebene Recht zur individuellen und kollektiven Selbstverteidigung» (Art.
51).
Was heißt das im Fall des Saddam Hussein?
Dass ihn das Völkerrecht
nicht interessiert, dass er einen achtjährigen Krieg gegen den Iran führte und
dazu ein Biowaffenprogramm entwickelte - beides mit tatkräftiger Unterstützung
der USA -, dass er Senfgas gegen die eigene kurdische Bevölkerung einsetzte,
dass er Kuwait überfiel, dass er heute «Märtyrerprämien» für die
Hinterbliebenen von palästinensischen Selbstmordattentätern ausrichtet, das
alles wissen wir. Ein «Schurke» war Saddam schon immer. Sein schlimmstes
Verbrechen aber scheint zu sein, dass er nicht mehr Amerikas «Schurke» ist.
Der Sicherheitsrat hatte
nach dem 2.Golfkrieg mit der Resolution 687 die Fahndung nach
Massenvernichtungswaffen im Irak verfügt. Die UNO-Inspektoren arbeiteten
während knapp acht Jahren mit einigem Erfolg. Sie stießen auf Nuklearfabriken,
auf fast 40 000 chemische Sprengköpfe und auf mehr als 800 Scud-Raketen. 1998
hat Saddam die Inspektoren vertrieben, mit der allerdings nicht ganz abwegigen
Begründung, dass unter den Inspektoren auch CIA-Agenten gewesen seien.
Jedenfalls war der
amerikanische Geheimdienst über diese Inspektionen jeweils besser und schneller
informiert als die UNO-Zentrale. Inzwischen gibt es amerikanische und britische
Dossiers, die beweisen wollen, dass Saddam wieder über ein ganzes Arsenal an
chemischen und biologischen Waffen verfüge. Diese Dossiers rechtfertigen
allenfalls neue Waffeninspektionen, aber
gewiss nicht den Krieg, den
Bush will. Unter dem Druck der Weltöffentlichkeit und nach der Ankündigung aus
Riad, dass Saudi-Arabien sich einer UNO-Aktion gegen den Irak nicht
verschliessen könne, ist Saddam heute wieder bereit, UNO-Inspektoren ins Land
zu lassen. Hans Blix, der Chef der UNO-Abrüstungsmission im Irak, meint: «Die
Inspektionen könnten in einem Jahr abgeschlossen sein, und das Land hätte eine
Chance, wieder in die Weltgemeinschaft aufgenommen zu werden - wenn wir nicht
fündig werden» (Spiegel, 39/02). Das geht Bush aber viel zu lang. Er hat schon
längst beschlossen, einen Enthauptungsschlag gegen Saddam zu führen. Und was,
wenn der Sicherheitsrat nichts oder im Sinne der USA nicht genug unternimmt?
Kann Bush dann für die USA das Recht auf « Selbstverteidigung » reklamieren?
Selbstverteidigung gegen einen Angriff, der irgendeinmal drohen könnte? Das
wäre kein Verteidigungs-, sondern ein «Präventivkrieg», der das Völkerrecht
eindeutig verletzte. Abenteuerlich wären die politischen Folgen für andere
Konfliktherde. Es gibt genügend Potentaten, die offene Rechnungen mit einem
«Präventivschlag» begleichen möchten. Russlands Putin propagierte eben noch
einen Angriff auf Georgien als «Akt der Selbstverteidigung» (TA 13.9.02).
Indien könnte mit gleicher Begründung Pakistan angreifen. Und China könnte
versucht sein, einer Unabhängigkeitserklärung Taiwans auf diese Weise
zuvorzukommen. Wie anders als durch «antizipatorische Selbstverteidigung» aber
kann ein Land sich gegen Terrorismus wehren, der ja plötzlich und ohne
Vorwarnzeit zuschlägt? Die Frage ist falsch gestellt. Erstens gibt es keine
Anhaltspunkte dafür, dass Saddam Terrorakte gegen die USA unterstützen würde.
Zweitens hilft gegen Terrorismus kein Krieg, wie das Beispiel Afghanistan
zeigt. Gegen Kriminelle gibt es drittens und rechtens nur die Strafverfolgung.
Wer Krieg gegen sie führt, macht sie zu Kombattanten und spielt damit ihr
Spiel.
Was soll ein UNO-Krieg
gegen den Irak?
Ein UNO-Mandat wäre
unabdingbar, um militärische Sanktionen gegen den Irak zu legitimieren. Aber
wäre es auch hinreichend, um sie rechtlich, politisch oder gar moralisch zu
rechtfertigen? Selbst wenn der Sicherheitsrat den USA grünes Licht für einen
Militärschlag gegen das Regime von Saddam Hussein gäbe, stünde ein solcher
Beschluss nicht ohne weiteres im Einklang mit der UNO-Charta. Diese kennt
nämlich keine Generalermächtigung, durch die der Sicherheitsrat irgendwelchen
Staaten erlauben dürfte, im Namen der UNO Krieg zu führen. Es ist der
Sicherheitsrat, der Sanktionen ausspricht, durchführt und für beendet erklärt
(Art. 42). Die Staaten haben ihm zu diesem Zweck «Streitkräfte» zur Verfügung
zu stellen (Art. 43f.). Seit dem letzten Golfkrieg passiert jedoch das genaue
Gegenteil: Der Sicherheitsrat «autorisiert» die USA und
deren «Alliierten» zu einer
neuen Art von «gerechtem Krieg». Der Sicherheitsrat gibt damit das Heft aus der
Hand, er kann nicht einschreiten, wenn die Kriegführung alle Proportionen
sprengt, und er hat keine Befehlsgewalt, um der verbliebenen Supermacht einen
Waffenstillstand oder das Kriegsende zu diktieren. Soll sich das Desaster vom
Frühjahr 1991 wiederholen, als der Irak während 40 Tagen mit 100 000
«chirurgischen Eingriffen» bombardiert wurde, die wenigstens 300 000 Tote
hinterließen? Colin Powell, der als besonnen geltende heutige US-Außenminister,
führte als damaliger Stabschef der US-Armee einen eigentlichen
Vernichtungskrieg gegen die irakische Armee. Traurige Berühmtheit erlangte sein
Wort, er wolle die 500 000 irakischen Soldaten erst einmal (von ihren
logistischen Verbindungen) «abschneiden und dann töten (kill)» (TA 25.1.91).
Der US-amerikanische Soziologe Norman Birnbaum verwies auf eine beängstigende
Kontinuität des Genozids in der US-amerikanischen Politik: «Das amerikanische
Niedermetzeln der bereits fliehenden irakischen Armee, deren Regierung schon um
Frieden nachsuchte, war gekennzeichnet von der gleichen Noblesse wie das
Abschlachten der Indianer» (Spiegel.18.3.91). Der Sicherheitsrat hatte sich der
Möglichkeit begeben, die von ihm erlaubten Kampfhandlungen auf ihre
Verhältnismäßigkeit zu prüfen. Er handelte insofern nicht mehr «im Einklang mit
den Zielen und Grundsätzen der Vereinten Nationen» (Art. 24 Abs. 2).
Es sieht ganz so aus, als
würde er unter dem Druck der USA zu einer Wiederholung dieser Tragödie Hand
bieten. «Die UNO muss sich entscheiden, ob sie Durchsetzungskraft zeigen will»,
pflegt Bush zu sagen, wenn er die Weltorganisation mit seinen Ultimaten
eindeckt, als sei er ihr oberster Auftraggeber und Kriegsherr.
Eine sowohl ethische als
auch politische Frage betrifft das Ziel des geplanten Militärschlags. Geht es
um die Beseitigung Saddam Husseins? Aber wer soll an dessen Stelle treten? Und
mit welcher Legitimation? Die von Washington hofierten Exilgruppen verfügen
über keinen Rückhalt in der irakischen Bevölkerung. Darum rechnen
Nahost-Experten damit, dass 100 000 Soldaten während fünf Jahren im Land für
Ruhe und Ordnung sorgen müssten.
Oder geht es um den viel
beschworenen «Krieg gegen den Terrorismus»? Genau diesen Krieg könnte
verlieren, wer den Krieg gegen Saddam Hussein gewinnt. Demütigung schafft
Feinde. Gegen Selbstmordattentäter hilft keine noch so hochgerüstete
Invasionsarmee.
Oder geht es nur ums Erdöl?
Schon Vater Bush hatte den 2. Golfkrieg um diese wirtschaftliche Lebensader des
American Way of Life geführt. Mit Bush jr. haben erneut die Ölhändler die Macht
übernommen, die ja auch seinen Wahlkampf finanzierten. Bereits der
Afghanistankrieg wurde um Öl und Gas geführt. Jetzt geht es um die Ausbeutung
der zweitgrößten Erdölreserven der Welt. Der Chef des US-Geheimdienstes, James
Woolsey, plauderte kürzlich gegenüber der Washington Post aus der Schule, dass
die «USA alles in ihren Kräften Stehende tun werden, damit die neue irakische
Regierung und die US-Ölgesellschaften gut zusammenarbeiten werden». Und dafür
soll die UNO eine Kriegs- und Tötungslizenz ausstellen?
Die Gegenfrage sei erlaubt:
Was könnte mit den 50 bis 200 Milliarden Dollar gemacht werden, wenn sie statt
in den Krieg in den Frieden im Nahen Osten investiert würden? Oder in die
Sonnenenergie, die den Krieg um Öl erst recht als antiquiert erscheinen ließe?
Aber solche Überlegungen würden Herrn Bush überfordern. Für den «terrible
simplificateur» reduziert sich alles auf einen «Konflikt zwischen Gut und
Böse». Am Ende glaubt er noch selbst daran.
Willy Spieler, Redaktor von
"Neue Wege - Zeitschrift des Religiösen Sozialismus"
aus: Neue Wege -
Zeitschrift des Religiösen Sozialismus, Nr.10/2002, 96.Jahrgang, Zürich
(Schweiz)